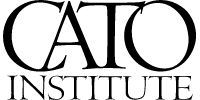Vom Wert der Schöpfung und vom Schöpfen der Werte
Anlässlich der Weltausstellung ‘500 Jahre Reformation’ wurde 2015 ein internationaler Wettbewerb zur Gestaltung der ‘7 Tore der Freiheit’ veranstaltet. Mit ihrem Entwurf zur Gestaltung des Torraums 4 “Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung” konnten die Studenten der FH Salzburg (Design / Produktmanagement und Soziologie) unter der akademischen Leitung von Dr. Michael Leube (Prof. an der FH Salzburg und der Liechtenstein Academy) die internationale Jury überzeugen. Das grosse Projekt umfasste mehrere Stufen. In workshops an verschiedenen Universitäten Europas wurden zunächst von Studenten gemeinsam mit Asylsuchenden und Professoren Konstruktionen aus wiederverwendbaren Hölzern geflochten. Diese labilen Bootstrukturen wurden anschliessend an den Schwanenteich ins Zentrum Wittenbergs gebracht, wo sie nun symbolisch fuer das massenhafte Sterben im Mittelmeer, treiben. Als ein Zeichen der Hoffnung wurde in einem nächsten Schritt eine Art Sakralraum als offene Kuppelanordnung aus den gleichen Materialien gefertigt und unter die mächtigen Eichen am Rande des Teiches gestellt. Als besonders berührendes Monument der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Tragik steht über dem Teich ein vor Sizilien aufgebrachtes Flüchtlingsboot aus Libyen.
Der folgende Vortrag wurde von Dr. Hardy Bouillon (Professor an der Universität Trier und an der Liechtenstein Academy) anlässlich eines workshops unter Leitung von Dr. Michael Leube im Torraum 4 der Weltausstellung am 28. Juni 2017 gehalten.
Vom Wert der Schöpfung
und vom Schöpfen der Werte
Essay von Prof. Dr. Hardy Bouillon
Böse Zungen behaupten, die Philosophie zeige uns, was das Mögliche sei, überlasse den Menschen aber die schwere Entscheidung, was das Richtige sei. Das nenne sie dann weise. Aber in Wirklichkeit lasse sie den Menschen einfach nur im Regen stehen.
So, nun habe ich Ihnen gleich zu Beginn eingestanden, mit welch zweifelhaften Tricks wir Philosophen arbeiten; angeblich arbeiten. Aber ganz so übel sind wir nicht, denn auch dann, wenn wir Ihnen einen Schirm anbieten wollten, würde dieser sich als ein sehr löchriges Utensil entpuppen, das immer noch genug Wasser durchließe, um darunter nass zu werden. Der Grund für diese Misere ist ein sehr schlichter. Es gibt keinen Schirm, mit dem man sich vor der Erkenntnis schützen könnte. Und die Erkenntnis in diesem Fall lautet, wie so oft: Zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte, gibt es keine Brücke. Die Erkenntnis, dass es in einer bestimmten Situation ein, zwei oder gar mehrere Entscheidungsoptionen gibt, erlaubt keine Schlussfolgerung darüber, welche der Optionen zu wählen wäre. Wenn sie überhaupt so etwas wie eine Schlussfolgerung gestattet, dann die, dass man bestenfalls sagen kann, welche Entscheidung man nicht präferieren sollte; nämlich die, welcher einer der alternativen Entscheidungen nach Abwägung aller maßgeblichen Faktoren unterlegen zu sein scheint. Zu dieser Entscheidungsfrage komme ich noch; später. Für den Moment dürfte ein kurzer Verweis auf den schottischen Philosophen David Hume genügen. Hume verdanken wir die Distinktion von Sein und Sollen, die – vereinfacht ausgedrückt – nichts anderes zum Ausdruck bringt als die Einsicht, dass wir von dem, was ist, nicht auf das schließen können, was sein wird oder gar sein soll; jedenfalls nicht in logisch gültiger Form. Der Schluss ist deshalb logisch ungültig, weil in ihm die Konklusion mehr enthält, als durch die Menge der Prämissen gedeckt ist. Die Prämissenmenge (das, was ist) sagt uns leider nicht, was sein wird, was sein soll. Wie gemein von ihr!
Ich werde nicht ganz so gemein sein wie die Prämissenmenge und Ihnen sagen, was sein wird, genauer: was Sie erwarten wird – und – inwieweit dies mit meinen Anfangsbemerkungen zusammenhängt. Der Zusammenhang ist ein denkbar einfacher.
Wäre es nicht wünschenswert, wenn uns die Erkenntnis in den Wert der Schöpfung erkennen ließe, wie wir mit diesem Wert umgehen sollten? Sie ahnen womöglich, worauf ich hinauswill, nämlich auf eine These, eine ganz bestimmte These. Sie lautet: Die Erkenntnis in den Wert der Schöpfung lässt nicht auf den Umgang mit dieser Erkenntnis schließen. Selbst wenn man diese logische Unmöglichkeit in ihr Gegenteil verkehren könnte, hätte man noch ein anderes Problem zu bewältigen, nämlich nachzuweisen, dass die propagierte Erkenntnis auch eine zutreffende Erkenntnis ist. Mit diesem Problem werde ich mich nicht befassen. (Es zu tun, würde den heutigen Rahmen sprengen.) Stattdessen will ich nur der Frage nachgehen, vor welcher Entscheidung wir stehen, wenn wir einen Wert der Schöpfung unterstellen und diesen bzw. die Schöpfung erhalten wollen.
Man könnte nun meinen, diese Frage zu beantworten, falle nicht schwer; man brauche nur die Natur in all ihrer Vielfalt und all ihrem Reichtum anzuschauen, um zu erkennen, was zu tun sei: bewahren, konservieren; auf jeden Fall könne man nicht die verschiedenen Formen und Mengen der Natur (also die Spezies und die Ressourcen) aufbrauchen; wenn schon die Natur von uns verlangt, Ressourcen zu nutzen, dann doch bitteschön so, dass neue Ressourcen nachwachsen, nachwachsen können; idealerweise in einem Umfang, der die Ausgangslage nicht verschlechtert, sondern nach Möglichkeit sogar verbessert, nachhaltig eben.
Die Idee der Nachhaltigkeit ist – das wird man kaum bestreiten können – ihrem Grundgedanken nach sehr plausibel. Insofern könnte man dem Philosophen sagen: So, pack Dein Manuskript wieder ein. Angesichts des Offensichtlichen fällt die Entscheidung gar nicht so schwer. An und für sich gibt es auch gar keine Alternative, zumindest keine, die der offensichtlichen Lösung überlegen wäre.
Nun, ganz so einfach liegen die Dinge nicht. Zugegeben: die populäre Version der Nachhaltigkeit, die ich eben kurz zu umreißen versucht habe, hat eine beeindruckende Anfangsplausibilität. Den Fundus (die Schöpfung) wahren, womöglich die Ressourcen vergrößern, verbessern, zumindest aber erhalten und auf keinen Fall mindern oder verschlechtern: das ist ein Ziel, das man nicht so einfach vom Tisch wischen kann. Ich will auch keinen gegenteiligen Versuch unternehmen. Ich will vielmehr etwas mehr auftischen, etwas, das die Frage aufwirft, wie dieses Ziel am besten zu erreichen sei und ob wir – in Beantwortung dieser Frage – womöglich dieses Ziel an der einen oder anderen Stelle zu korrigieren hätten. Nun denn Philosoph, probiere Dein Glück!
Zunächst einmal gilt es, eine Klarstellung vorzunehmen. Wenn wir davon sprechen, die Schöpfung wahren zu wollen, dann können wir mit der Schöpfung den Prozess meinen, in dem sie sich vollzieht, oder die Produkte, die sie in diesem Prozess erzeugt. Wer die Schöpfung ausschließlich aus der Produktperspektive betrachtet, wird es schwer haben, dem Ziel der Schöpfungswahrung zu entsprechen; ganz einfach deshalb, weil in der Natur ein ständiges Kommen und Gehen herrscht. Jede Momentaufnahme hat einen individuellen Korb an Produkten, der von einer Sekunde auf die andere anders gefüllt ist – auch ohne unser Zutun. So gesehen, ist es unmöglich, sinnvoll davon zu sprechen, die Schöpfung zu bewahren. Versteht man aber die Schöpfung in erster Linie als Prozess, dann liegen die Dinge anders. Nun kann man sehr wohl in sinnvoller Weise davon sprechen, den Prozess aus Kommen und Gehen wahren zu wollen; oder – alternativ – ihn zerstören zu wollen. Bezogen auf die Welt wäre z.B. die Vernichtung aller Lebensgrundlagen eine Zerstörung, während das Intaktlassen des Prozesses permanenten Wandels einer Wahrung der Schöpfung als Prozess gleichkäme. Die Schöpfung als Prozess zu begreifen, hat noch einen weiteren Vorteil: Der Mensch muss nicht permanent seinem Ziel zuwider handeln. Er kann viele einzelne Schöpfungsprodukte (z.B. Krankheitserreger, Überschwemmungen, Waldbrände) auslöschen bzw. löschen, ohne dabei den Schöpfungsprozess und den Umstand, dass es auch künftig Schöpfungsprodukte gibt, zu zerstören. Er kann Ressourcen nutzen, um sein Leben und das Leben anderer zu gewährleisten.
Eingedenk dieser Klarstellung wollen wir nun dort beginnen, wo das Ziel der Schöpfungswahrung noch problemlos vollendbar zu sein scheint. Beginnen wir also, gewissermaßen, im Paradies. Unter paradiesischen Umständen gibt es keine Ressourcenknappheit, um am Leben zu bleiben. Die verbrauchten Ressourcen wachsen von alleine nach. Der englische Philosoph John Locke glaubte, dass derlei paradiesische Zustände zu seiner Zeit, d.h. gegen Ende des 17. Jahrhunderts, noch anzutreffen waren. Sollte Locke recht gehabt haben, dann muss irgendwann in den letzten 300 Jahren jener Tag zumindest hier und da eingetreten sein, an dem diese Ära zu Ende ging. Dank Robert Malthus wissen wir, dass wir Menschen, wie andere Spezies auch, die Tendenz haben, uns zu vermehren, und zwar geometrisch, d.h. in einem höheren Maße als die uns zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen, was zu uns zu Konkurrenten bei der Nutzung bestehender Mittel macht. Angesichts der sich geometrisch vermehrenden Bevölkerung kann die Wahrung der Schöpfung (inkl. der Wahrung des Menschen als Teil der Schöpfung) also nicht gelingen, indem man nur das Vorhandene nutzt. Lassen wir den Dingen ihren Lauf, dann hat der Mensch die natürlichen Ressourcen irgendwann aufgebraucht. Dann wird es eng. Egal, wann und wo dieser entscheidende Moment auftaucht: wenn er eintritt, dann steht der Mensch vor der Entscheidung, die ich eingangs erwähnt habe. Dann nämlich steht er vor der Frage, wie er mit seinem Ausgangsziel umgehen wolle. Steht er dazu, auch weiterhin die Schöpfung wahren zu wollen, und hält er an der Nachhaltigkeitsidee mit der hohen Ausgangsplausibilität fest, dann bleibt ihm nur eine Option. Er muss mit den Ressourcen schonender umgehen, weniger verbrauchen, um für die Anderen, die an Zahl zunehmen, genug und gleich Gutes (um es in der Sprache Lockes zu sagen) übrig zu lassen.
Eine Weile wird uns diese Entsagungstechnik gelingen. Wovon 10 satt werden, werden auch 11 satt, vielleicht sogar 12. Aber danach wird es langsam knapp, und schon bald sind wir mit der Strategie des Einschränkens am Ende. Nun fällt es schwerer, an der anfänglichen Nachhaltigkeitsidee festzuhalten. Doch noch ist nicht alles verloren. Der Mensch ist erfinderisch. Freunde der Feuerzangenbowle und nicht nur diese kennen das Friedrich II. zugeschriebene Zitat: „Wer es fertigbringt, zwei Halme wachsen zu lassen, wo bisher nur ein Halm wuchs, ist größer als der größte Feldherr.“
Die Botschaft des alten Fritz rettet also die Nachhaltigkeitsidee vor dem geometrischen Wachstum der Bevölkerung. Aber sie tut es nur, wenn es gelingt, zwei Halme wachsen zu lassen, wo bisher nur ein Halm wuchs; wenn es gelingt, Ressourcenwachstum und Bevölkerungswachstum einander anzugleichen. Wir wissen, dass diese Angleichung Wissen voraussetzt, die ständige Entwicklung neuer Theorien und Technologien, die dem Angleichungskriterium entsprechen. Ein einmaliges Aus-eins-mach-zwei reicht nicht aus. Wir brauchen permanente Verbesserungen, um dem Ziel Rechnung zu tragen. Damit sind wir beim zweiten Teil meines Vortragstitels angekommen, beim Schöpfen der Werte – wobei der Begriff Werte hier nichts anderes meint als die permanenten Verbesserungen zur Angleichung der beiden Wachstumsprozesse. (An späterer Stelle werden wir noch eine weitere Bedeutung des Begriffs kennenlernen.) Wir können hier also festhalten, dass man die natürliche Schöpfung, die von ungleichen Wachstumsprozessen gekennzeichnet ist, nicht wahren kann, ohne Werte zu schöpfen. Die lebensnotwendigen Ressourcen wären irgendwann aufgebraucht. (Gewiss – und das sollte der Vollständigkeit halber erwähnt werden – bestünde auch die Möglichkeit, das Bevölkerungswachstum zu stoppen oder umzukehren. Wer diese Möglichkeit präferiert, kann das Thema der Wertschöpfung außer acht lassen.)
Wir aber verweilen noch beim Verhältnis von Schöpfungswert und Wertschöpfung und stellen uns dabei der Frage, was es denn brauche, damit Werte geschöpft werden können. Das Schöpfen der Werte ist kein rein technologisches Problem. Es ist nicht so, dass man sagen könnte: Auf, auf, lasst uns gute Erfindungen ersinnen, um dem Problem Herr zu werden. Erfindungen und Entdeckungen geschehen nicht einfach auf Zuruf. Sie brauchen ein gewisses Umfeld, um in die Welt zu kommen. Bitten, Appelle und Befehle reichen nicht aus.
Wenn es uns gut geht, wenn wir nichts entbehren, und wenn es so aussieht, als ob sich an diesem Zustand zumindest auf absehbare Zeit nichts änderte, dann haben wir keinen Grund, erfinderisch zu sein. Es besteht keine Not, die Lage zu ändern. Erst dann, wenn wir Bedürfnisse empfinden, die wir nicht oder nicht vollständig befriedigen können (weil die dazu notwendigen Mittel zu knapp sind), haben wir einen Anreiz, die Lage ändern zu wollen. Mit anderen Worten: Der Mensch muss unbefriedigt sein, unbefriedigt aufgrund der Tatsache, dass die Mittel zur Befriedigung zu knapp sind.
Die Praxeologie des Ökonomen Ludwig von Mises fußt genau auf diesem ursächlichen Zusammenhang, der zwischen Güterknappheit und Unbefriedigtsein besteht. Wir Menschen, so Mises, handeln aus Bedürfnissen heraus. Wir trachten danach, die empfundenen Bedürfnisse zu befriedigen, ziehen das Befriedigtsein dem Unbefriedigtsein vor. Für Mises lag der Antrieb allen Handelns im „Unbefriedigtsein“ und in der – ich zitiere – „Möglichkeit der Behebung oder Milderung dieser Unzufriedenheit durch das eigene Verhalten:“ (1) „Das Handeln“, so Mises weiter, „muss sich durch die Unzulänglichkeit der Versorgung beengt fühlen, damit es Handeln werde. … Wären die Mittel im Hinblick auf das Unbefriedigtsein nicht knapp, so würde nicht gehandelt werden[.]“ (2)
Bezogen auf unser Thema können wir also sagen: Wenn eine Erfindung oder Entdeckung unser Unbefriedigtsein in ein Befriedigtsein verwandeln kann, dann haben wir eine Ursache, zu handeln, erfinderisch zu sein, auf Entdeckerreise zu gehen.
Dass der Mensch die Zufriedenheit der Unzufriedenheit vorzieht, ist eine weithin geteilte Einsicht. Wer wollte ihr Gegenteil behaupten? Der Mensch strebt nach Lust und meidet Leid. Das sah schon Aristoteles so. Der Umstand, dass man die Lust dem Leid vorzieht und beide, Lust und Leid, in unterschiedlicher Intensität (von schwach bis stark) und zu unterschiedlichen Zeiten (gegenwärtig oder künftig) eintreten können, impliziert fünf Präferenzverhältnisse, die dem Menschen innewohnen – gewissermaßen 5 anthropologische Grundkonstanten, die man für unsere Zwecke wie folgt wiedergeben kann:
1. Der Mensch zieht Güter Übeln vor.
2. Er zieht große Güter kleinen Gütern vor.
3. Er bevorzugt kleine Übel gegenüber großen Übeln.
4. Er konsumiert Güter lieber früher als später.
5. Übel erleidet er indes lieber später als früher.
Bezogen auf unser Thema ist unmittelbar ersichtlich, welche Handlungen wir von Menschen demnach zu erwarten haben, wenn sie den eingangs erwähnten ungleichen Wachstumsprozessen gegenüber stehen: Sie begreifen die Ressourcenknappheit als ein Übel und deren Abwesenheit als ein Gut; als ein Gut, das sie dem entsprechenden Übel vorziehen. Und nicht nur das: Sie ziehen es auch vor, die Ressourcenknappheit lieber schnell als langsam und lieber in höherem Maße als in einem geringeren Maße hinter sich zu lassen.
All dies spricht dafür, dass der Mensch ein Interesse daran hat, die Schöpfung, verstanden als Prozess, zu wahren und zu diesem Zweck die sie potentiell in Gefahr bringenden Ressourcenknappheiten schnell, effizient und dauerhaft zu minimieren. Um diesem Interesse im Einklang mit seinen übrigen Interessen bzw. Bedürfnissen gerecht zu werden, muss der Mensch das Verhältnis berücksichtigen, das zwischen seiner allgemeinen Interessenlage und den Ressourcen besteht.
Ressourcen sind nicht per se unseren Interessen dienlich, sondern müssen erst die Eigenschaft der Zweckmäßigkeit erhalten. Dieser Umstand führt mich zu einem Versprechen, das ich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor ca. 15 Minuten gegeben habe. Es ist an der Zeit, dieses Versprechen einzulösen. Ich versprach noch einen weiteren Sinn vom Schöpfen der Werte darzulegen; einen Sinn, der etwas anderes meint als die Idee, Bevölkerungs- und Ressourcenwachstum kontinuierlich besser aneinander anzugleichen. Gemeint ist die Idee, dass Dinge, also auch Ressourcen, keinen Wert an sich darstellen, sondern nur als Mittel zur Befriedigung von Bedürfnissen.
Ich weiß, dass diese Vorstellung manchen bitter aufstößt, vor allem jenen, die davon ausgehen, dass Dinge nicht bzw. nicht nur Zwecken dienen sollten, sondern zweckfrei oder Zweck an sich seien. Die Philosophie hat immer wieder und mit unterschiedlichen Phasen der Intensität um das Verhältnis zwischen Ding und Zweck gerungen. Ich will und kann dem Disput hier nicht Rechnung tragen. Nur so viel: Dinge nicht als Mittel zu sehen, entspricht der Idee, die Schöpfung vornehmlich als Produkt zu verstehen, und ist dementsprechend auch den Schwierigkeiten ausgesetzt, die mit dieser Vorstellung einhergehen. Ein Verbot, Dinge auch als Mittel zu sehen, würde jegliches Leben unmöglich machen.
Für unsere Zwecke ist ungeachtet all dessen der Umstand von Bedeutung, dass Dinge Zwecke erfüllen können und dass sie dies nur können, wenn sie die Eigenschaft erfüllen, Mittel zu sein; Mittel zur Befriedigung von Bedürfnissen bzw. Nachfragen.
Der Ökonom Carl Menger hat diesen Sachverhalt in bestechend klarer Weise zum Ausdruck gebracht, als er schrieb: „Damit ein Ding ein Gut werde, oder mit andern Worten, damit es die Güterqualität erlange, ist demnach das Zusammentreffen folgender vier Voraussetzungen erforderlich:
1. Ein menschliches Bedürfniss.
2. Solche Eigenschaften des Dinges, welche es tauglich machen, in ursächlichen Zusammenhang mit der Befriedigung dieses Bedürfnisses gesetzt zu werden.
3. Die Erkenntnis dieses Causal-Zusammenhanges Seitens der Menschen.
4. Die Verfügung über dies Ding, so zwar, dass es zur Befriedigung jenes Bedürfnisses tatsächlich herangezogen werden kann.“ (3)
Damit Dinge bzw. Ressourcen zweckdienlich werden können, ist oft mehr als das schlichte Aneignen verlangt. Kartoffeln müssen nicht nur geerntet, sondern auch geschält und gekocht werden, bevor man sie essen kann. Öl muss erst raffiniert und kontrolliert abgebrannt werden, damit man es zum Heizen nutzen kann. Kurz: Die Nutzung von Ressourcen stellt oft technische Herausforderungen an uns. Aber nicht nur die! Wäre die Ressourcennutzung lediglich eine technische Frage, dann könnte der Mensch alles daran setzen, den gewünschten Zustand herbeizuführen. Aber die Ressourcennutzung ist auch eine wirtschaftliche Frage. Niemand setzt all seine Mittel ein, um ein Problem zu lösen, sondern nur einen Teil derselben, und zwar nach Abwägung all seiner Ziele angesichts knapper Mittel. Die Ziele des Menschen konkurrieren um die Mittel, über die der Mensch verfügt, um seine Ziele zu verwirklichen. Vereinfacht ausgedrückt: wir gehen haushälterisch mit unseren Mitteln um. Oder, um es in der Worten von Hans Mayer – eines zeitgenössischen Ökonomen von Mises – zu sagen:
„Ein technisches Problem entsteht, wenn es ein Ziel gibt und viele Mittel, ein wirtschaftliches Problem hingegen, wenn es sowohl viele Ziele als auch viele Mittel gibt.“ (4)
Was für die Verwendung von Ressourcen im Hinblick auf die damit verbundenen technischen und wirtschaftlichen Probleme gilt, gilt auch für die Minderung ihrer Knappheit. Kartoffeln müssen nicht nur geerntet, sondern auch angemessen und wirtschaftlich eingekellert werden, Öl muss nicht noch gefördert, sondern auch sachgerecht und haushälterisch gelagert werden. Dabei kommt uns Menschen ein bestimmter Umstand zupass: Zwar rivalisieren die Ziele um die Mittel. Aber auch das Umgekehrte gilt: Die Mittel konkurrieren um die Ziele. Glücklicherweise gibt es verschiedene Lebensmittel und unterschiedliche Brennstoffe. Wenn wir keine Kartoffeln haben, dann können wir Pfannkuchen essen. Ist uns das Öl ausgegangen, dann können wir mit Holz heizen. D.h., Minderung von Ressourcenknappheit bedeutet nicht zwangsläufig die Knappheitsminderung einer bestimmten Ressource, sondern lediglich die Minderung der Knappheit in einer bestimmten Klasse von Ressourcen, die allesamt geeignet sind, das bestehende Bedürfnis zu befriedigen. Ein zweiter Glücksfall gesellt sich zu dem ersten: Die Klassen jener Mittel, die unsere Bedürfnisse befriedigen können, sind offen. Wir kennen nicht alle Repräsentanten, ihre Anzahl kann wachsen. Vor 200 Jahren wurde unser Bedürfnis, zu reisen, hauptsächlich mittels Pferden, Kutschen und Schiffen befriedigt. Inzwischen sind andere Verkehrsmittel (Autos, Motorräder, Züge, Flugzeuge etc.) vorhanden, um dem Bedürfnis nachzukommen.
Dass die Klasse der Verkehrsmittel heute reichhaltiger ist als früher, hat gewiss viele Gründe. Einer der wichtigsten liegt wohl in dem Umstand, dass es überhaupt möglich ist, neue Werte in dem oben beschriebenen Sinn zu schöpfen. Je weniger ein Milieu von äußeren Störfaktoren eingeschränkt ist, desto leichter fällt den in ihm agierenden Akteuren, neue Werte zu schöpfen.
Skeptiker wiederum verweisen darauf, dass in einem solchen Milieu der eigennützige Mensch auch Neuschöpfungen verfolge (verfolgen könne), die der Schöpfung als Ganzer abträglich sein könnten. Gewiss ist diese Möglichkeit ein ernstzunehmendes Problem, ebenso wie das Problem, dass gutgemeinte Einschränkungen von Eigennutz ebenfalls zu einer Gefahr der Schöpfung als Ganzer werden können. Zu beiden Problemen ließe sich vieles anführen, das hier allerdings aus Platzgründen außen vor bleiben muss. Gleiches gilt für den Eigennutz, dessen Ausmaß und dessen Verhältnis zum Fremdnutz.
Meines Erachtens ist die Position, die der eingangs erwähnte David Hume in dieser Frage vertrat, nicht nur eine, die vermittelnd wirkt, sondern auch jene, welche der Wirklichkeit am nächsten kommt. Hume bietet ein dreistufiges System der Zuneigungskategorien Selbstliebe, Nächstenliebe und Fernstenliebe an. Für ihn war klar, dass – ich zitiere – „ein jeder Mensch sich mehr liebt, als eine andere einzelne Person und bei seiner Liebe gegen andre nur seinen Verwandten und Freunden die größte Zärtlichkeit beweist …“v Und weiter heißt es bei ihm: „Weit entfernt zu glauben, daß die Menschen nur für ihr eigenes Selbst Interesse haben, bin ich der Meinung, daß, wenn man auch selten jemand finden mag, der eine einzelne fremde Person mehr liebt als sich selbst, man doch ebenso selten jemand begegnet, dessen wohlwollende Regungen zusammen genommen nicht seine selbstischen Neigungen überwögen.“vi In der Sache heißt das wohl folgendes: Der Mensch liebt sich zwar mehr als jeden anderen, aber weniger als seine Familie und seine Freunde zusammengenommen. So gesehen, ist Nachhaltigkeit zu erwarten, wenn wir die Natur walten lassen. Das natürliche Interesse, es unserer Familie und unseren Nachkommen gut gehen zu lassen, überwiegt das ebenfalls natürliche Interesse, nur zu eigenen Zwecken die natürlichen Ressourcen zu nutzen.
Das Vertrauen darin, dass die Wertschöpfung den Schöpfungswert bewahren hilft, wird aber weniger von der Eigennutzfrage auf die Probe gestellt, als durch einen anderen Umstand, der eine sorgfältige Erörterung verdient. Gemeint ist das auf den ersten Blick paradox wirkende Verhältnis von Knappheit und Wertschöpfung. Nicht der Reichtum an Ressourcen fördert die Wertschöpfung, sondern die Knappheit derselben. Das Schöpfen neuer Werte profitiert von dem Umstand, dass die alten Werte knapp sind. Erfindungen finden meistens dann statt, wenn an einem Mittel, das ein Bedürfnis erfolgreich befriedigt, ein Mangel entsteht. Werden wichtige Rohstoffe knapp, findet man alsbald Ersatzstoffe; leiden viele Patienten an einer neuen Krankheit, dann werden kurz darauf Gegenmittel gesucht und gefunden. Wird eine vielfrequentierte Passstraße unbefahrbar, dann lässt die Entdeckung einer neuen Route nicht lange auf sich warten.
Dass dem so ist bzw. oft so ist, haben wir nicht irgendwelchen magischen Kausalverhältnissen zu verdanken. Es gibt keinen Automatismus, der von der Knappheit zur Erfindung führte. Gleichwohl wissen wir: Not macht erfinderisch. Sie tut dies, indem sie Anreize bildet, die vorher nicht gegeben waren, die aber nun alle Interessierten anlocken, eine Lösung zu finden, die gewinnbringend einsetzbar ist. D.h., die Wahrscheinlichkeit neuer Wertschöpfung liegt in der Knappheit von Lösungen, die mittels der neugeschöpften Werte herbeigeführt werden können. Die Wahrscheinlichkeit bietet indes keine Sicherheit, keine Gewissheit. Gegen viele endemische Krankheiten gibt es nach wie vor keine Medikamente.
Die unüberbrückbare Distanz zwischen hoher Wahrscheinlichkeit und prinzipieller Ungewissheit hinterlässt ihre Spuren. Für die einen ist sie Anlass zur Skepsis am Verfahren, den Schöpfungswert durch Wertschöpfung zu bewahren. Andere fordert sie heraus, über die scheinbar magischen Kausalverhältnisse nachzudenken, die eine Notlage – und die Knappheit erwünschter Lösungen ist eine solche Notlage – zum Geburtshelfer neuer Lösungen macht.
Diese Herausforderung hat aus meiner Sicht mindestens zwei interessante Denkfiguren hervorgebracht, die ich hier kurz skizzieren will. Beide Denkfiguren entstammen dem, was man im weitesten Sinne evolutionäre Denkmuster der Schöpfungsidee nennen könnte. Beide Denkmuster rekurrieren auf Selektionsprozesse, wobei in dem einen Fall das Selektionsverfahren als ein positiver Prozess zu deuten ist, und in dem anderen Fall als ein negativer Prozess. Was heißt das?
Unter einer positiven Selektion ist hier ein Prozess zu verstehen, der aufgrund eines vorgegebenen Kriteriums das Ergebnis bestimmt. Ob das Ergebnis ein „positives“, begrüßenswertes Ergebnis ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle, und ob das zu erwartende Ergebnis tatsächlich erzielt wird, spielt ebenfalls keine Rolle. Nehmen wir die Entscheidung von Michael Leube, für heute den vor Ihnen stehenden Referenten zu einem Vortrag über Schöpfungswert und Wertschöpfung einzuladen. Sie ist eine positive Selektion in dem Sinne, dass sie die Kriterien erkennen lässt, die festlegen, was das Ergebnis sein soll. Ob Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, nun das gemäß der Kriterien hervorgegangene Ergebnis begrüßen oder nicht, ist jedoch offen. Vielleicht denken Sie: „Das hätte ich mir besser schenken sollen.“ Wer weiß!
Und auch dann, wenn der Vortrag heute Abend aus irgendeinem Grunde ausgefallen wäre, würde dies nichts daran ändern, dass die Entscheidung von Michael Leube selbst eine positive Selektion zu nennen wäre. Soviel zum Begriff „positive Selektion“. Beispiele für positive Selektionen in diesem Sinne gibt es zuhauf. Ob wir nun an Kinder denken, die festlegen, nach welchen Regeln Verstecken gespielt werden soll (1,2,3,4 Eckstein, alles muss versteckt sein … ) oder an die Regeln, nach denen auf Facebook oder Twitter Nachrichten zu versenden sind, oder an irgendeinen anderen Fall, in dem eine Referenzgröße die Referenzkriterien für das Referenzergebnis festlegt, ist letztlich unerheblich. Auch die theologische Schöpfungsvorstellung kann letzten Endes als Beispiel einer positiven Selektion gedeutet werden. In diesem Beispiel ist Gott derjenige, der die Kriterien festlegt, nach denen die Schöpfung abläuft. D.h., Gott ist die Referenzgröße. Er legt die Referenzkriterien der Schöpfung fest, und die Welt, so wie sie ist, ist das Referenzergebnis.
Interessant für unsere Zwecke sind vor allem jene Beispiele positiver Selektionen, die neben dem Referenzergebnis (manchmal sogar statt des Referenzergebnisses) ein anderes, ein spontanes Ergebnis zutage fördern. Diese Beispiele sind es, die zur ersten jener vorhin genannten zwei Denkfiguren führen, die man im weitesten Sinne evolutionäre Denkmuster der Schöpfungsidee nennen kann. Sie führen zu David Hume und Charles Darwin genauso wie zu Karl Popper oder Friedrich August von Hayek.
Nehmen wir Darwin! Für Darwin war die Schöpfung neuer Hunderassen nicht das Ergebnis menschlicher Handlungen, die dem primären Ziel folgen, neue Rassen zu züchten, sondern dem primären Ziel der Gewinnmaximierung. „Für unseren Zweck jedoch“, schrieb Darwin, „ist diejenige Art von Zuchtwahl wichtiger, welche man die unbewußte nennen kann und welche das Resultat des Umstandes ist, daß Jedermann von den besten Thieren zu besitzen und nachzuziehen sucht. So wird Jemand, der Hühnerhunde halten will, natürlich zuerst möglichst gute Hunde zu bekommen suchen und nachher die besten seiner eigenen Hunde zur Nachzucht bestimmen; dabei hat er aber nicht die Absicht oder die Erwartung, die Rasse hierdurch bleibend zu ändern.“ (7)
Darwin sagte damit, dass Werte auch dann geschöpft werden können, wenn es gar nicht die Absicht war, diese Werte zu schöpfen. Das Phänomen spontaner Wertschöpfung nimmt somit unverkennbar Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass Knappheit neue Werte hervorbringt. (Man muss allerdings hinzufügen, dass nach demselben Muster auch Wertzerstörung eintreten kann, die ebenfalls auf die besagte Wahrscheinlichkeit Einfluss zu nehmen in der Lage ist.)
Die zweite der beiden genannten Denkfiguren ist ungleich komplexer und unserem Alltagsdenken weitaus weniger vertraut als die erste. Anders als die positive Selektion legt die negative Selektion die Kriterien der Auslese nicht fest. Da aber auch sie zu einer Selektion führt (ansonsten wäre der Terminus negative Selektion widersinnig), stellt sich die Frage, wie man das negative Verfahren, das zu einem Selektionsergebnis führt, zu verstehen habe.
Ich räume ein, die Antwort auf diese Frage fällt nicht leicht. Ich habe dazu einen ausführlichen Vorschlag gemacht (etwa 300 Buchseiten dick; also nicht gerade das, was man auf einer Seite kurzfassen könnte). Der Vorschlag kursiert gerade unter wohlwollenden Kollegen, die so freundlich sind, ihre wertvolle Zeit darauf zu verwenden, ihn kritisch zu lesen. (Unter Ihnen sitzt einer davon, Professor Kurt Leube, der mir fahrlässigerweise diesen Freundschaftsdienst erweist. Das hat er nun davon.)
Schön und gut, einiges zur Denkfigur negativer Selektion lässt sich in aller Kürze denn doch sagen; und auch dazu, inwiefern dies helfen mag, zu verstehen, wie Wertschöpfung stattfinden kann. Folgt man der Idee negativer Selektion, dann tritt ein Ereignis ein, weil ein Ereignis eintreten muss und aufgrund der konstitutiven Bedingungen kein alternatives Ereignis eintreten kann. In diesem Sinne sind die Resultate negativer Selektionen erzwungene Ergebnisse.
Um das Gesagte an einem Bild zu illustrieren: Denken Sie an einen Glücksautomaten, und zwar an einen jener Sorte, die auch heute noch gerne von Schaustellern genutzt werden, um Kirmesbesuchern das Geld aus der Tasche zu locken. Worum geht es bei diesen Automaten? Nun, der Glückspieler soll Münzen einwerfen. Er soll seine Münze dabei so lancieren, dass sie vor einen Schieber fällt, der eine Vielzahl von gleichen Münzen auf dem Weg zur Absturzkante vor sich hertreibt. Mit etwas Glück bleibt die eingeworfene Münze so liegen, dass gleich mehrere Münzen ein entscheidendes Stücken über die Kante hinausgeschoben werden und in den Gewinnschacht fallen. In den meisten Fällen bleibt dieses Glück aus, aber gelegentlich tritt es ein, dass der Absturz auslösende Schwellenwert erreicht wird.
Sie können das Bild auch auf andere Situationen übertragen. Nehmen Sie das Beispiel von vorhin, in dem ich meinem Kollegen Michael Leube unterstellt habe, den Referenten des heutigen Abends im Stile einer positiven Selektion eingeladen zu haben. Wir können uns das Verfahren auch als negative Selektion vorstellen. Dann liegen die Dinge ganz anders: Unser Gastgeber hat dann über Wochen und Monate verzweifelt nach dem passenden Redner für die heutige Veranstaltung gesucht, aber nur Absagen erhalten, bis schließlich nur noch eine Alternative übrigblieb: Und die steht nun heute Abend vor Ihnen. Pech für Sie!
Wie dem auch sei! Das Ursachenverhältnis für negative Selektionen ist in der Regel erheblich komplexer, und auch komplizierter, als im Beispiel des Glückspielsautomaten, der entweder Geldstücke oder Referenten auf dem Weg zur Absturzkante vor sich hertreibt. Die Entscheidung wird nicht nur eindimensional herbeigeführt. Es ist nicht so, dass immer nur in einer Dimension oder in einer Kategorie eine kritische Größe, ein Schwellenwert erreicht werden müsste, der, einmal erzielt, das in Frage stehende Ergebnis hervorbrächte. Es spricht vieles dafür, dass im Regelfall mehrere Dimensionen bzw. Kategorien interagieren und so den ereignisauslösenden Schwellenwert erzeugen. Um im Bild zu bleiben: Dass einige Münzen über die Absturzkannte fallen, hängt nicht nur davon ab, wie dichtgedrängt die Münzen im Automaten beieinander liegen, sondern auch davon, in welchem Neigungswinkel der Automat steht, ob er erschütterungsfrei steht oder nicht, etc.
Ob der Hefekuchen aufgeht, hängt nicht allein vom Mengenverhältnis der beigemischten Hefe ab, sondern auch von der Hitze, dem verwendeten Mehl. Allgemeiner und abstrakter gesagt: Ob der Schwellenwert für ein Ereignis erreicht wird, hängt nicht nur vom Verhältnis ab, das in einer Kategorie herrscht, sondern auch von den Verhältnissen in den anderen Kategorien und schließlich vom Verhältnis, in dem diese Kategorien untereinander stehen.
Ich gebe zu, meine kurzen Anmerkungen lassen bestenfalls erahnen, was mit dem Prozess negativer Selektion gemeint ist und inwiefern er dazu beitragen kann, die nach wie vor weitgehend unbekannten Kausalverhältnisse aufzudecken, die beim Schöpfen von Werten unter Knappheit herrschen. Ich wollte Ihnen mit meiner groben Skizze nur vor Augen führen, dass es Anlass gibt, künftig auf etwas mehr Licht im Dunkel der besagten Kausalverhältnisse zu hoffen.
Fassen wir zusammen:
Man kann versuchen, den Wert der Schöpfung zu bewahren, indem man das asymmetrische Verhältnis zwischen natürlichem Bevölkerungswachstum und natürlichem Ressourcenwachstum durch kontinuierliches Entsagen anzugleichen trachtet. Die Aussichten auf Erfolg sind, wie ich darzulegen versucht habe, gering. Die hier vorgestellte Alternative liegt im Betrachten der Schöpfung als Prozess und im Schöpfen von Werten unter Knappheit. Die wertschöpfungsfördernde Wirkung der Knappheit kann zwar nicht die Gewissheit bieten, stets zu neuen Wertschöpfungen zu führen, aber sie erhöht die Wahrscheinlichkeit neuer Wertschöpfung und damit die Angleichung der asymmetrischen Wachstumsprozesse. Hinzu kommen die spontanen Wertschöpfungen, die ebenfalls unter Knappheit zustande kommen. Sie im Rahmen einer Denkfigur zu begreifen, der wir den Namen positive Selektion gaben, lenkte unseren Blick auf eine andere Denkfigur, nämlich auf die negative Selektion, und auf die Möglichkeit, mithilfe dieser Denkfigur die Kausalzusammenhänge besser zu verstehen, die Wertschöpfungen unter Knappheit zustande kommen lassen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, eingangs sprach ich davon, dass man angesichts alternativer Entscheidungsoptionen keine Option präferieren sollte, die nach Abwägung aller maßgeblichen Faktoren einer der Alternativen unterlegen zu sein scheint. Die Aussage war sehr allgemein gefasst und sollte dem Umstand Rechnung tragen, dass die Zahl der Entscheidungsoptionen in vielen Fällen größer als zwei ist. Gewiss wird es auch mit Blick auf das Schöpfungsthema einige Alternativen geben; mehr als nur die zwei, die ich miteinander verglichen habe. Steht eine Entscheidung an und hat man nur zwei Alternativen zur Wahl, dann ist die Nicht-Wahl der einen Option natürlich gleichbedeutend mit der Wahl der anderen Option. Die Option, den Schöpfungswert gemäß der eingangs skizzierten populären Nachhaltigkeitskonzeption zu bewahren, ist zwar mit einer hohen Anfangsplausibilität verbunden, ist aber auch, soweit mir scheint, der Alternative, die auf Wertschöpfung setzt, deutlich unterlegen, und folglich nicht zu wählen.
Prof. Dr. Hardy Bouillon
Extracurricular Professor of Philosophy, Trier University
Fellow, Liechtenstein Academy
http://www.publicpartners.de
Original downloaden ->
Vom Wert der Schöpfung und vom Schöpfen der Werte
(Word Doc, 90kb)
Fussnoten:
(1) Ludwig von Mises (1940): Nationalökonomie. Theorie des Handelns und Wirtschaftens, München 1980, S. 30f.
(2) Mises (1940), S. 66.
(3) Carl Menger: Grundsätze der Volkswirthschaftslehre, Wien: Braumüller 1871, S. 2f.
(5) David Hume (1739): Über die menschliche Natur, Band II, in der Übersetzung von Ludwig Heinrich Jakob, Halle 1791, S. 57.
(6) Ibid., S. 56f.
(7) Charles Darwin: Entstehung der Arten: Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe um’s Dasein, aus dem Englischen übersetzt von H. G. Bronn, Stuttgart 18766, S. 53.