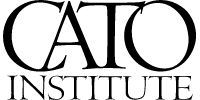Postintelligente Wissenschaft – Warum Covid-19 eine Grundlagenkrise des Denkens offenbart
Seuchen sind mitnichten nur eine medizinische Herausforderung. Seuchen stellen ganz wesentlich Fragen der Ethik. Das gilt besonders, wenn eine Seuche mit rechtlichen Mitteln bekämpft werden soll. Denn Seuchen bringen Recht und Gesetz an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Das systematische Wesen von Rechtsregeln ist nämlich, dass sie einen klar definierten Tatbestand mit einer ebenso deutlich konturierten Rechtsfolge verknüpfen. Auf diese Weise verfolgt das Recht seinen Zweck, die Erwartung an menschliches Verhalten für jedermann einschätzbar und damit kalkulierbar zu machen. Was aber, wenn schon die Tatsachengrundlage, an die ein Gesetz anknüpfen will, ihrerseits unsicher ist oder ganz fehlt? Was, wenn den Entscheidern – den Regelgebern ebenso wie den Regelanwendern – die nötigen Informationen für eine verlässliche Einschätzung der Faktenlage fehlen? Die betroffenen Akteure stehen dann allesamt auf unsicherer Tatsachengrundlage. Und genau diese Tatsachenunsicherheit zwingt sie vor jeder Entscheidung zum Tätigwerden zur Beantwortung einer vorgreiflichen Frage. Die lautet: Können und dürfen wir überhaupt aktiv etwas tun, oder sind wir aufgrund unseres mangelnden Wissens nicht vielmehr gehalten, abzuwarten und mindestens bis auf weiteres gar nichts zu tun?
Im Angesicht einer Gefahr neigen die meisten Menschen erfahrungsgemäß dazu, lieber aktiv zu werden als passiv zu bleiben. In Schockstarre zu verfallen und dem Schicksal seinen Lauf zu lassen, ist üblicherweise nicht die erste Option, die Betroffene wählen. Wo der Panische wegrennt, sehen Gruppenanführer sich dann gehalten, Aktivität zu zeigen, um sich und anderen irgendwie ihre Führungsstärke zu beweisen. Ein Mensch der Tat bleibt nicht bewegungslos, wenn eine Bedrohung naht. Sein Selbstverständnis treibt ihn zur Aktion. Auch ein Gesetzgeber bleibt daher in solchen Fällen nicht gerne still, sondern er greift zur aktiven Handlungsvariante. Er erlässt eilends Krisengesetze und Notverordnungen, um sich erst gar nicht dem Vorwurf hilfloser Untätigkeit auszusetzen.
Aber auch die vitalste Bereitschaft, Regeln formulieren zu wollen, beseitigt den Mangel der fehlenden Tatsachenkenntnis naturgemäß nicht. Also formuliert eine solchermaßen zum Äußersten entschlossene Legislative einen ganz besonderen Typus der Rechtsregel: Sie kombiniert eine unspezifisch formulierte Voraussetzungsseite dieser Norm mit einer gleichfalls unspezifisch formulierten Rechtsfolgenseite. Rechtsvorschriften dieser Art ordnen dann in der Sache zwar nur an, dass irgendjemand, falls nötig, das Erforderliche bewirken kann. Das ist in der Substanz der rechtlichen Verhaltenssteuerung kaum mehr als ein Nichts. Aber es lässt sich mit solchen Gesetzesinitiativen immerhin zeigen: Wir haben die Gefahr gesehen. Wir sind zu allem entschlossen. Und egal, wie sich die Lage entwickelt: Wir sind handlungsfähig!
Juristische Ermächtigungen solch unspezifischer Art erwecken zwar schnell auch die rechtspolitische Kritik, es seien dadurch bedenklich schrankenlose Generalvollmachten erteilt. Der Normgeber tritt derartigen Vorwürfen dann aber meist damit zur allgemeinen Beruhigung entgegen, dass er die Befugnisse des Zuständigen vorerst zeitlich befristet oder dass er sie dahin eingrenzt, nur Zumutbares anordnen zu dürfen. Hilfsweise fügt er gewisse tatbestandliche Spezifikationen bei, die die semantische Leere des machtverschaffenden Rechtssatzes erträglicher erscheinen lassen. Bisweilen wird zur rechtspsychologischen Entschärfung in der Norm das handelnde Subjekt grammatikalisch ausgespart, um die in Wahrheit schon bald vor Ort um Orientierung ringenden Beamten in den Hintergrund der öffentlichen Kognition treten zu lassen. Der Phantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt. In Paragraf 16 Absatz 2 des deutschen Bundespolizeigesetzes heißt es zum Beispiel: „Kommen zur Abwehr einer Gefahr mehrere Mittel in Betracht, so genügt es, wenn eines davon bestimmt wird.“
Formulierungen wie diese liefern dem Rechtssuchenden, der gesetzliche Antworten auf rechtliche Fragen sucht, erkennbar nur Steine statt Brot. Im Ergebnis all dessen bleibt es dabei: Solche Gesetze bieten auch dem gesetzestreuesten Normanwender keinerlei substantiellen Halt für sein Handeln. Welche Gefahr? Welche Mittel? Um was abzuwehren? Wohin und wie weit? Wer bestimmt über Voraussetzungen und Folgen? Was genügt? Kurz: Wer in derart unsicherer Lage mit reinem Herzen eine richtige Entscheidung treffen will, dem bleibt bei alledem nichts anderes, als ganz zwangsläufig auf Erwägungen der Ethik zurückzugreifen: Was muß ich nun, was darf ich jetzt tun?
Da nicht nur Juristen mit Tatsachenunkenntnissen dieser Art im Prinzipiellen hadern, sondern bekanntermaßen auch Politiker und Wissenschaftler, lohnt ein heuristisch vergleichender Blick über den engen rechtlichen Tellerrand hinaus: In jüngerer Vergangenheit ist an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik bekanntlich der Versuch unternommen worden, unter wirklichen oder vermeintlichen Handlungszwängen die herkömmlich ethisch abwägenden Problemlösungsmethoden aufzugeben und derartige Probleme nun mit einem Paradigma namens „postnormaler Wissenschaft“ zu lösen. Einer postnormalen Wissenschaft in diesem Sinne bedürfe es demnach, wenn vier Elemente einer Problemsituation gegeben sind: Wenn die Tatsachengrundlagen für eine bestimmte Entscheidung unsicher, die dabei betroffenen Werte streitig, die Einsätze erheblich und der Zwang zur Entscheidungen dennoch dringend seien.
In solchen vierfach problematischen Lagen dürfe man sich demnach ganz legitim von der traditionellen Suche nach faktischer Wahrheit und dem Streben nach rationalen Beweisbarkeiten lösen und stattdessen willkürliche Setzungen für das Handeln nach eigenen Qualitätsvorstellungen vornehmen. Exemplarisch reklamiert aktuell die Klimawissenschaft für sich die Befugnis, mangelndes Faktenwissen durch wertorientierte Handlungsoptionen dieser Art ersetzen zu dürfen. Wenn alles auf dem Spiel stehe, sei der handelnde Mensch mithin nicht mehr verpflichtet, die tatsächlichen Grundlagen seiner Entscheidungen und seines Handelns zu erforschen, sondern die Logik des politischen Willens zur Handlung sei in der Abwägung schwerer zu gewichten als die Logik der vorerst demütig nach Fakten suchenden Wissenschaft.
In diesem Konstrukt treten eigene Tatsachenspekulationen des Akteurs also an die Stelle der Mühe, andere mit intersubjektiv überprüfbaren, unwiderlegten Erkenntnissen von der Praktikabilität einer beabsichtigten, für die Gesellschaft insgesamt relevanten Handlung zu überzeugen. Aus dem fehlenden Wissen aller wird somit eine Legitimation für eigene normative Setzungen abgleitet. Je größer die befürchtete Gefahr, desto umfänglicher folglich auch die Erlaubnis des Gesetzgebers, in dieser Postnormalitätshypothese Rechtsgehorsam von jedem einzelnen zu erzwingen.
Das Ergebnis einer derart „postnormalen“ Wissenschaft ist nicht nur die faktische Ermächtigung desjenigen zum entscheidungsbefugten Herrscher, der gerade – umständehalber – in der Position ist, durch eine institutionelle Verknüpfung der Postwissenschaftler seines Vertrauens mit den Instrumentarien der Staatsgewalt zu seiner Verfügbarkeit ganz traditionell politische Macht über andere auszuüben. Das Ergebnis derartiger Postnormalität ist auch, dass die akademischen Werte der forschenden Wissenschaft, namentlich Skepsis und Ergebnisoffenheit alles systematisch-kritischen Suchens, aufgegeben werden. Bei genauer Betrachtung wird offenbar, dass jene scheinbar revolutionär neue strategische Methode für die Lösung gesellschaftlicher Problemlagen alles andere als postwissenschaftlich ist. Denn sie nimmt die fruchtbare Skepsis der Wissenschaft nicht in sich auf, sondern sie wirft deren stetigen Selbstzweifel ersatzlos über Bord. An der Stelle des geduldigen Suchens nimmt sie damit das ungeduldige Mutmaßen zur Basis ihres Entscheidens und Handelns. Tatsächlich ist sie damit nicht postwissenschaftlich, sondern eher präwissenschaftlich, wenn nicht gar non-wissenschaftlich, da sie Wissen durch Glauben ersetzt. Ihr Ansatz fällt hinter die historisch gewonnene Erkenntnis zurück, dass ein jedes rationales, geordnetes und zielgerichtetes Handeln des Menschen in der realen Welt eine verlässliche Orientierung des Handelnden in dieser realen Welt voraussetzt.
Wo aber Wissen über Tatsachen als Grundlage für Handlungen fehlt, da sind Eingriffe in das Gegebene in jedem Falle dann nicht klug, wenn sie ihrerseits Unabänderbares schaffen. Ein vorgefundenes großes Chaos lässt sich nicht dadurch beherrschbar ordnen, dass man ihm willkürlich ein unbeherrschtes weiteres, kleines Chaos hinzufügt. Auf unsicherer Tatsachengrundlage kann also auch in ethischer Hinsicht allenfalls legitim sein, Schritte zu gehen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jederzeit wieder vollständig rückgängig zu machen sind. Je weniger Wissen vorhanden ist, desto dringender ist folglich die Notwendigkeit, wie in einem dunklen Keller allenfalls tastend voranzuschreiten, um – in kleinsten Handlungsschritten operierend – beim Erkennen potentiell schadensgeneigter Entwicklungen stets sofort umkehren zu können.
Juristen haben jedenfalls seit langem verstanden, dass nicht legitim ist, auf der Basis von Tatsachenzweifeln unabänderbare Eingriffe in die Wirklichkeit vorzunehmen. In ihrer Theorie und in ihrer Praxis haben sie daher ein fein verästeltes Instrumentarium entwickelt, mit faktischer Unsicherheit zu operieren: Im Zweifel verurteilen Richter keinen Angeklagten, weil sie wissen, dass ihm – erwiese sich seine Unschuld im Nachhinein – die verlorene Zeit einer Gefängnisstrafe nie wieder zurückgegeben werden könnte. Im Zweifel weisen Richter auch zivilrechtliche Klagen ab, wenn ein Anspruchsteller seine Behauptungen über ein besseres Recht an einem Gegenstand nicht beweisen kann. Die Beweislast liegt bei dem, der eine Veränderung des aktuell Vorgefundenen erstrebt. Und im Zweifel ordnen Richter verwaltungs- oder verfassungsrechtlich keine vorübergehenden Änderungen der Sachlage per Eilentscheidung an, weil sie ihren sorgfältigen Prüfungen in einem Hauptsacheverfahren nicht faktisch vorgreifen mögen.
Übertrüge man nun die Ansprüche jener hier skizzierten „postnormalen“ Wissenschaft mit ihren vier Elementen auf das Gebiet der Juristerei, so würden alle gerichtlichen Entscheidungen unter Tatsachenunsicherheit nur noch nach dem Maßstab zu fällen sein, ob der zum jeweiligen Urteil berufene Richter zufällig die Werte der einen oder der anderen Streitpartei teilt. Denn Streit ist der jeweilige Kern eines jeden Gerichtsprozesses und um Entscheidungen geht es dort auch ausnahmslos. Die Übertragung des Gedankens von der „Postnormalität“ in den Gerichtssaal macht somit evident, warum der Verzicht auf die Last der vorherigen Tatsachenermittlung kein Vehikel sein kann, das in einem gesellschaftlichen Umfeld qualitativ bessere Entscheidungen ermöglichen könnte. Wo Tatsachenunsicherheit herrscht, bleibt dem Menschen im Juristischen wie im Politischen keine andere Handhabe, als mit den traditionellen Instrumenten des ethischen Abwägens zwischen realistisch gegebenen Handlungsoptionen zu wählen. Und diese Abwägung hat Wahrscheinlichkeiten zu gewichten.
Dass ein derartiges Abwägen bei Tatsachenunsicherheiten keine einmalige und historisch ungesehene, hochaktuelle Herausforderung für den modernen Massenmenschen in der Globalisierung darstellt, sondern im Gegenteil seit jeher eine geradezu elementare Grundfrage der menschlichen Existenz vorgibt, zeigt das in Deutschland jüngst öffentlich debattierte Schicksal einer beliebten TV-Moderatorin. Zufällig war bei ihr im Jahre 2009 ein Hirnaneurysma entdeckt worden, von dem Ärzte annahmen, es könne möglicherweise platzen und sie töten. In der Abwägung mit den Risiken einer Operation entschied sie sich seinerzeit für den Eingriff, der aber – mit dann fatalsten beruflichen und familiären Konsequenzen – vollends misslang. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag erklärte sie nun, sie würde sich in solcher Lage retrospektiv nie wieder für die Beseitigung der abstrakten Gefahr aus dem entdeckten Aneurysma entscheiden. Augenscheinlich haben die konkreteren Risiken der tatsächlich durchgeführten Operation für sie in ihrer Abwägung schlimmere Folgen hervorgebracht als es der ansonsten abstrakt drohende Tod in ihrer heutigen subjektiven Bewertung hätte tun können. Abstrakt in diesem Sinne sind also Gefahren, die sich zwar als mögliche Konstellation gedanklich konturenscharf beschreiben lassen, von denen sich aber (noch) kein greifbares Element in der Realität findet. Konkrete Gefahren sind demgegenüber solche, die in ihrer Konstellation nicht nur bildlich beschreibbar sind, sondern von denen sich einzelne Elemente bereits tatsächlich in der Welt verwirklicht haben.
Man muß allerdings nicht einmal auf derartige Krankheitsrisiken blicken, um die alltägliche Gegenwart solcher Abwägungsherausforderungen zu erkennen. Während die genannte Moderatorin die unmittelbaren Folgen ihrer eigenen gesundheitlichen Abwägungsentscheidung für sich ganz alleine tragen muß, beziehen ethische Abwägungen zwischen konkreten und abstrakten Gefahrenlagen andernorts auch sehr oft weitere Beteiligte mit ein. Auch solche Konstellationen sind im Alltag weitaus häufiger und lebensnäher, als man gemeinhin denken könnte. Wer je als Radfahrer – unter den kontinentaleuropäischen Bedingungen des Rechtsverkehrs – in der Lage war, von einer vielbefahrenen Straße nach links in eine Seitenstraße abzubiegen, der kennt die Fragen, die sich ihm dann stellen: Bleibt er am zunächst konkret sichereren rechten Fahrbahnrand, bis er die Seitenstraße erreicht hat, so wird er dann wohl – abstrakt gefährlicher – zwei Fahrbahnen überqueren müssen. Entscheidet er sich hingegen, rechtzeitig in einer Lücke zwischen der Autokolonne in seiner Fahrtrichtung zur Straßenmitte hin zu wechseln, dann wird er dort nur – konkret ungefährlicher – eine einzige (Gegen-)Fahrbahn überqueren müssen, um seine Zielstraße zu erreichen. Bis dahin bewegt er sich aber – abstrakt wiederum gefährlicher – mitten auf der Straße zwischen dem hektischen Kraftverkehr auf beiden gegenläufigen Fahrbahnen.
Aus der Perspektive des Radfahrers wird ein Entscheidungsbündel dieser Art im Straßenverkehr üblicherweise nicht als eine auch ethische Herausforderung begriffen, weil er bei alledem (als der relativ ungeschützt Schwächere gegenüber den vorbeifahrenden Fahrzeugen) ernsthafte Schadensgefahren allenfalls für sich selbst, nicht aber auch für andere begründet. Dass die Bewältigung der allgegenwärtigen Tatsachenunsicherheiten im Straßenverkehr indes ganz deutlich auch ethische Dimensionen hat, wird umgekehrt klar, sobald man in der beispielhaften Betrachtung nur die Blickrichtung zwischen Auto- und Fahrradfahrer wechselt: Auch ein Autofahrer muß nämlich immer wieder auf unsicherer Tatsachengrundlage Abwägungsentscheidungen für sein Verhalten treffen. Seine handlungsleitenden Entscheidungen zur Bewältigung abstrakter oder konkreter Gefahren erfolgen hier geradezu ununterbrochen und auch noch in Sekundenschnelle. Zudem betreffen sie – in der Gestalt beispielsweise eines weitgehend ungeschützten Radfahrers – sehr unmittelbar Leib und Leben anderer Menschen.
Das Überholen eines Radfahrers vor der Kurve auf einer steil ansteigenden, engen Bergstraße beispielsweise bedeutet für den Autofahrer in ethischer Formulierung: Wieviel Abstand halte ich seitlich zu dem Radfahrer, um weder ihn konkret zu gefährden, noch dabei zugleich das weitere abstrakte Risiko zu begründen, mit einem möglicherweise bergab entgegenkommenden Dritten frontal zu kollidieren?
In einer solchen Lage auf der Bergstraße kann kaum legitim sein, aus Sorge vor jedwedem abstrakt möglichem Gegenverkehr so nah an den konkret tatsächlichen Radfahrer heranzusteuern, dass dieser infolge physisch oder psychisch vermittelter Kausalitäten den Abhang herabstürzt. Eher wird sich ein verantwortungsbewusster Autofahrer vorläufig so lange hinter dem Radfahrer halten, bis ihm das Risiko des Überholens unter der Annahme eines nicht seinerseits verantwortungslos schnell entgegenkommenden Dritten in der gesamthaften Abwägung für alle Beteiligten tragbar erscheint. Das ist weder postnormal, noch methodisch außergewöhnlich, sondern es entspricht schlicht den Anforderungen, die das praktische Leben an ein funktionierendes Miteinander unter Menschen in der Welt stellt.
Bei dem Versuch, die weltweite „Corona-Krise“ rund um das Covid-19-Virus angemessen zu bewältigen, haben Politiker anfangs allerorten vor mannigfaltigen tatsächlichen Unsicherheiten gestanden. Unklar war zunächst jedenfalls, wo sich das Virus bereits befand, wie es übertragen wurde, für wen es welche Gefahren barg, wie ihm oder seinen Konsequenzen begegnet werden konnte und für welche Zeiträume Maßnahmen zu ergreifen waren. Es galt mithin, einer vielgestaltig abstrakten Gefahrenlage entgegenzutreten. Auf einer engen Bergstraße hörte man also gleichsam von oben ein Motorengeräusch, doch es war nicht zu erkennen, ob es zu Gegenverkehr gehörte, wie breit dieser war oder mit welcher Geschwindigkeit er sich möglicherweise näherte. Gleichwohl entschlossen sich Politiker fast überall auf der Welt dafür, mit einem „Lockdown“ des öffentlichen Lebens die abstrakte Gefahr eines etwaigen Gegenverkehrs für schwergewichtiger zu halten als die Aufrechterhaltung des konkreten Wirtschafts- und Sozialllebens. Anders als der Autofahrer in diesem Beispiel stand der handlungswillige Politiker zwar in der heraufziehenden „Corona-Krise“ in dem zusätzlichen Dilemma, sich in Raum und Zeit keine zusätzlichen Überlegungsspielräume dadurch schaffen zu können, dass er erst einmal langsam hinter dem Radfahrer herfuhr. Die Politik entschied sich gleichwohl, in jener gegebenen Lage der Tatsachenunsicherheit trotz fehlender Überlegungsfristen gezielt so nah an den dadurch ausgebremsten Radfahrer heranzufahren, dass dieser im Ergebnis gegen die Leitplanke geriet und den Hang herabfiel: Der gesellschaftliche Zusammenhalt zwischen den Menschen wurde durch Zerschlagung arbeitsteiliger Prozesse schwer geschädigt.
Es steht bei alledem der Verdacht im Raum, dass die Vordenker der „postnormalen Wissenschaft“ auf jene politische Vorgehensweise nicht unmaßgeblich beeinflusst haben dürften. Den handelnden Politikern erschienen die epidemiologische Tatsachengrundlagen für ihre Entscheidungen unsicher, die betroffenen Werte von abstrakten Lebens- und Gesundheitsgefahren hier und gesellschaftlicher Strukturerhaltung dort waren streitig, die materiellen Einsätze waren erheblich und der Zwang zur Entscheidung erschien ihnen dringend. Analog zu den bereits eingeübten rhetorischen Topoi einer drängelnden Klimapolitik, denen zufolge man nicht warten dürfe, bis die maßgeblichen Fakten ermittelt sein werden, wurde auch hier nicht nur ein immenser emotionaler Handlungsdruck aufgebaut, sondern an mindestens einer Stelle darüber hinaus sogar vollends faktenfrei agiert: Soweit ersichtlich, hat nämlich niemand von denjenigen, die den „Lockdown“ anordneten, je konkret dessen unvermeidliche Folgen selbst systematisch und rational erforscht. Obwohl epidemiologisch seit über zwanzig Jahren weltweit – auch auf der Ebene der World Health Organization – Szenarien besprochen und sogar innerstaatlich eingeübt wurden, blieben alle Ermittlungen zu den gesellschaftlichen Folgen eines Lockdown aus. Eine Abwägung zwischen konkret umschriebenen Handlungsalternativen, zwischen Handeln und Nichthandeln, zwischen menschlichem Tun und menschlichem Lassen, konnte alleine dadurch nicht stattfinden. Gesetzgeber konnten folglich ihre legislative Einschätzungsprärogative und Verwaltungen ihre Ermessensspielräume gar nicht rational ausüben. Der Radfahrer wurde mithin ohne jede systematischen Folgenabwägungen in die Tiefe geworfen. Das ist aber einerseits ethisch nicht vertretbar und andererseits auch – in juristischen Kategorien – schlicht rechtswidrig. Versteht man Intelligenz als die Fähigkeit, zwischen den Zeilen lesen und interdisziplinäre Zusammenhänge geordnet erkennen zu können, dann ist das Ausblenden von Teilbereichen der Realität bei Handlungsentscheidungen schlicht unintelligent. Eine Wissenschaft, die jenseits der üblichen, normalen Rationalität stehen möchte, dürfte folglich postintelligente Wissenschaft sein. Wer sie proklamiert, ist kein Intellektueller, sondern ein Postintellektueller.
Mögen nach allem jene Richter, die in ihren Eilentscheidungen die politischen Weichenstellungen zunächst noch unangetastet gelassen hatten, weil sie – gerichtlich dogmengerecht – nicht an die Stelle einer legislativen Spekulation schlicht eine andere judikative setzen wollten, nun auf breiterer und rationaler Tatsachengrundlage entscheiden. Die Beurteilungen in den folgenden Hauptsacheverfahren werden absehbar andere sein müssen. Eine „postnormale Rechtsprechung“ kann und darf es nicht geben. Denn sie wäre zwangsläufig auch eine postintellektuelle. Ein solcher wissenschaftlicher und juristischer Postintellektualismus ist aber mit dem europäischen Weltbild der Aufklärung nicht vereinbar. Anders gesagt: Ein moderne Europäer glaubt nicht einfach unhinterfragt etwas und gibt sich nicht kopflos seiner Angst hin. Er findet stattdessen heraus, was der Fall ist, und stützt seine verantwortlich abwägende Entscheidung zum Tun oder zum Unterlassen auf rational strukturierte Handlungsvarianten. Auf dieser Grundlage wird deutlich, dass die künftige Aufarbeitung der Ereignisse um das Covid-19-Virus in der „Corona-Krise“ weit größere als nur medizinische oder epidemiologische Herausforderungen bergen wird. Das wissenschaftliche Weltbild der aufgeklärten, denkenden Moderne, die Werte unserer Rechtsordnung, unserer Kultur und unserer ethischen Standards – kurz: die Normalität des gewachsenen, westlichen Menschenbildes – sie stehen allesamt auf dem Prüfstand und müssen sich bewähren.
Carlos A. Gebauer ist ein deutscher Jurist und Autor, spezialisiert auf Medizinrecht. Sein Essay erschein erstmals im Juni 2020 auf hayekianer.ch